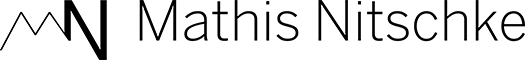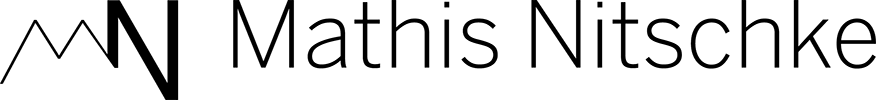Originalität ist einer jener Begriffe, die selbstverständlich wirken, bis man versucht, ihn zu definieren. Kaum ein Begriff wird in der Kunst selbstsicherer verwendet – und kaum einer bricht bei näherer Betrachtung schneller in sich zusammen. Von Künstler:innen wird erwartet, originell zu sein. Werke werden für ihre Originalität geschätzt. Rechtlicher Schutz hängt an ihr. Und doch weiß jede Person, die Kunst ernsthaft studiert oder praktiziert hat, wie fragil diese Idee ist.
Featured Image: Das romantische Ideal der Originalität — eine einsame Figur, über die Welt erhoben und doch auf einem Boden stehend, der von dem geformt ist, was ihr vorausging. (Caspar David Friedrich — Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818))
Die romantische Erfindung der Originalität
Die Vorstellung, dass Kunstwerke als radikal neue Ausdrucksformen aus einem individuellen Schöpfer hervorgehen, ist heute tief verankert. Sie bildet das dominante kulturelle Bild künstlerischer Produktion: der einsame Autor, die innere Stimme, die einzigartige Geste. Historisch gesehen ist dieses Bild jedoch erstaunlich jung.
Was sich in der europäischen Romantik herausbildet, ist nicht Kreativität als solche, sondern eine spezifische moralische Rahmung von Autorschaft. Künstlerisches Schaffen wird an innere Authentizität, Persönlichkeit und Genie gebunden. Das Kunstwerk ist nicht länger primär ein Beitrag zu einer gemeinsamen Tradition, sondern die Emanation eines individuellen Subjekts. Originalität beschreibt in diesem Sinne nicht einfach Differenz – sie wird zur Tugend (siehe Martha Woodmansee, The Genius and the Copyright).
Das ist deshalb relevant, weil es mit einer Phase zusammenfällt, in der Reproduktion in ökonomischem und politischem Maßstab bedeutsam wird. Druckerpressen, Verlage, Musikstecher und später die Tonträgerindustrie benötigen eine Möglichkeit, Exklusivität zuzuweisen. Der romantische Autor liefert genau das: eine kulturell überzeugende Figur, die privates Eigentum an kulturellem Ausdruck natürlich, ja notwendig erscheinen lässt (siehe Mark Rose, Authors and Owners).
Originalität ist mit anderen Worten nicht nur eine ästhetische Kategorie. Sie ist ein legitimierendes Narrativ.
Kopieren, nicht Kreativität, war das ursprüngliche Problem
Das Urheberrecht entstand nicht, weil die Gesellschaft plötzlich Kreativität belohnen wollte. Es entstand, weil Kopieren industriell möglich und ökonomisch disruptiv wurde.
Frühe Urheberrechtsregime lassen sich am besten als Systeme zur Regulierung von Reproduktion, Distribution und Marktordnung verstehen (siehe das Statute of Anne von 1710; historische Kommentierung). Die zentrale Frage war nicht, ob etwas metaphysisch neu war, sondern wer das Recht hatte, Kopien zu drucken, zu verkaufen und zu kontrollieren. Die Sprache von den „original works“ tritt erst später hinzu – als Mittel, diese Regime zu stabilisieren, indem Rechte an Autor:innen statt an Drucker gebunden werden.
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sie eine anhaltende Verwechslung offenlegt. Wir lesen das Urheberrecht häufig so, als ginge es um künstlerischen Wert. Das tut es nicht. Es geht um zuweisbare Kontrolle in einem System der Reproduktion (vgl. Peter Jaszi, Toward a Theory of Copyright).
Die romantische Idee der Originalität half, diese Bereiche miteinander zu verschränken. Sie erlaubte es dem Recht, sich auf einen intuitiven moralischen Anspruch zu stützen: Wenn ein Werk der authentische Ausdruck eines Individuums ist, dann fühlt sich unerlaubtes Kopieren wie eine Verletzung von etwas Persönlichem an. Die rechtliche Struktur gewinnt kulturelle Plausibilität.
Diese Plausibilität hat jedoch ihren Preis.
Was Künstler:innen früh lernen – und das Recht nur schwer akzeptiert
In ernsthafter künstlerischer Ausbildung stellt sich eine Einsicht schnell ein: Absolute Originalität existiert nicht. Kunst entsteht nicht ex nihilo. Sie ist relational, referenziell, iterativ. Stile werden erlernt. Formen werden übernommen. Techniken zirkulieren.
Dieses Verständnis ist keine postmoderne Provokation. Es ist grundlegende professionelle Alphabetisierung – explizit formuliert in Bewegungen wie Collage, Appropriation, Fluxus und Postmoderne (siehe z. B. Texte im Umfeld von Fluxus).
In der Musik wird das unausweichlich. Techno, Hip-Hop, Sampling, Remix-Kultur – diese Genres sind keine Ausnahmen von einer Originalitätsregel. Sie zeigen, dass die Regel selbst eine Fiktion ist (siehe Lawrence Lessig, Free Culture).
Und dennoch operiert das Urheberrecht weiterhin so, als ließen sich Werke eindeutig einzelnen Schöpfungsakten zuordnen.
Die daraus entstehende Lücke empfinden viele Künstler:innen intuitiv als eine Form von Gewalt: Das Recht scheint etwas zu verlangen, von dem die künstlerische Praxis weiß, dass es falsch ist.
Musik als Stresstest für Originalität
Nirgendwo tritt dieser Widerspruch deutlicher zutage als in der Musik.
Die westliche Musik operiert innerhalb eines endlichen Systems: einer begrenzten Anzahl von Tonhöhen, Skalen, harmonischen Funktionen und rhythmischen Strukturen. Musikalische Bedeutung entsteht nicht aus isolierten Elementen, sondern aus Mustern, Erwartungen, Timbre, Performance, Produktion und Kontext. Groove, Stimme, Klang und Aura sind mindestens ebenso wichtig wie Melodie oder Harmonie – oft wichtiger.
Das Urheberrecht hat musikalische Originalität jedoch historisch an das gebunden, was sich abstrahieren, fixieren und vergleichen lässt: notierte Melodie, harmonische Progression, formale Struktur. Das „Werk“ wird als etwas behandelt, das sich auf ein Leadsheet reduzieren lässt.
Diese Reduktion ist nicht konzeptionell unschuldig. Sie blendet systematisch genau jene Dimensionen von Musik aus, die Hörer:innen oft als am markantesten wahrnehmen: Klang, Textur, Timing, Artikulation, Performance.
Die Absurdität jüngerer Plagiatsklagen folgt direkt aus dieser Fehlanpassung. Ansprüche werden auf der Basis generischer Akkordfolgen, kurzer Ostinati oder stilistischer Ähnlichkeit erhoben – Elemente, die als gemeinsames musikalisches Vokabular fungieren (z. B. Williams v. Gaye; Gray v. Hudson; Skidmore v. Led Zeppelin). Gerichte schwanken zwischen der Zurückweisung solcher Klagen als zu generisch und ihrer indirekten Förderung, indem sie stilistische Ähnlichkeit als Beweismittel zulassen.
Das Ergebnis ist nicht der Schutz von Kreativität, sondern strategische Prozessführung. Das Urheberrecht wird zur Waffe, nicht zum Schutzmechanismus.
Der Richmond-Law-Professor Jim Gibson, Experte für Urheberrecht, erläutert die Entscheidung des Supreme Court im Led-Zeppelin-Verfahren zu „Stairway to Heaven“.
Free Culture und der Versuch, der Falle zu entkommen
Die Free-Culture- und Copyleft-Bewegungen der frühen 2000er-Jahre waren unter anderem eine Reaktion auf diese Blockade. Sie bestritten Autorschaft nicht, lehnten aber die Annahme ab, dass Exklusivität der Default sein müsse. Stattdessen experimentierten sie mit Lizenzsystemen, die Transaktionskosten senken, Wiederverwendung fördern und Ableitung als kulturelle Norm akzeptieren.
Creative Commons entstand in diesem Kontext als pragmatischer Kompromiss – nicht als Abschaffung des Urheberrechts, sondern als dessen Umprogrammierung (siehe Lessig).
Wenn diese Bewegung heute weniger sichtbar erscheint, heißt das nicht, dass sie gescheitert ist. Ihre Werkzeuge sind weit verbreitet. Verändert hat sich das Schlachtfeld. Plattformökonomien, Streaming und nun maschinelles Lernen haben den Ort von Extraktion und Kontrolle verschoben. Die Frage lautet nicht mehr nur, wer kopieren darf, sondern wer lernen darf.
Die Zukunft der Musik in Systemen des maschinellen Lernens wird nicht dadurch entschieden, ob Outputs Inputs ähneln. Sie wird dadurch entschieden, wie wir Teilnahme, Zuschreibung, Vergütung und Zugang in einer Welt organisieren, in der Lernen selbst industrialisiert ist.
Ein Konzept unter Druck – und warum das nützlich ist
Originalität ist eine Geschichte, die wir weiter erzählen, weil sie nützlich war. Sie rechtfertigte Eigentum. Sie stabilisierte Märkte. Sie ließ rechtliche Abstraktionen menschlich erscheinen.
Doch sobald wir genauer hinschauen – als Künstler:innen, als Hörer:innen, als Technolog:innen –, franst diese Geschichte aus. Kunst ist relational. Musik ist kollektives Gedächtnis. (Menschliches) Lernen ist Akkumulation, kein Diebstahl.
Mit dem Eintritt des maschinellen Lernens in die kulturelle Produktion wird Originalität zunehmend als Platzhalter für ungelöste Fragen von Zugang, Zuschreibung und Wertschöpfung verwendet. Der daraus entstehende Druck ist gerade deshalb nützlich, weil er den Begriff der Originalität wieder auf den Tisch bringt – nicht als Ideal, das es zu verteidigen gilt, sondern als Mechanismus, der untersucht werden muss.
Die Aufgabe besteht nun nicht darin, Originalität abzuschaffen oder in romantische Geniekonzepte zurückzufallen. Sie besteht darin, die Funktionsweise von Originalität innerhalb rechtlicher und technischer Systeme zu reformieren, sodass die Rechte von Autor:innen sinnvoll bleiben, ohne einen unmöglichen Standard absoluter Neuheit zu verlangen.
Wenn Originalität heute neu verhandelt wird, ist das kein kultureller Verlust. Es ist eine notwendige Anpassung. Das eigentliche Risiko liegt nicht in der Reform, sondern darin, an einem unveränderten Begriff festzuhalten und ihn eine Welt regulieren zu lassen, für die er nie entworfen wurde.