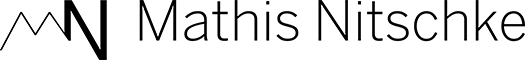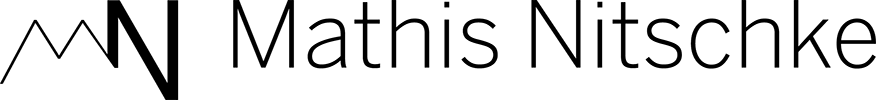Der Text entstand nach der Premiere von Ansichten eines Clowns, das Foto von David Balzer zeigt eine Szene daraus.
Ich selbst war und bin seit klein auf theaterbegeistert und hab darüber sogar mein Abitur eingebüßt: irgendwann verbrachte ich mehr Zeit in einem Münchner Privattheater (Gunnar Petersens Theaterzelt „Das Schloss“) als in der Schule. Damals Anfang der Neunziger habe ich technisch extrem fortschrittlich und sehr experimentell gearbeitet (als erstes Theater in München mit digitaler Schneide- und Zuspieltechnik). Viele der damaligen Surround- und Klangraumexperimente müssen sich auch vor heute üblichen Produktionsstandards nicht verstecken.
Wovon ich damals noch keine Ahnung hatte: wie und wann man sich in den Entstehungsprozess einer Theaterproduktion einklinken darf, soll und/oder muss. Es klingt selbstverständlicher als es oft praktiziert wird: gute Theaterarbeit ist Teamarbeit. Man begibt sich in einen kollektiven Entstehungsprozess und bringt sich dem Anderen hin gebend ein. Die eigenen Ideen und Ansichten tragen nur so weit, wie sie in den beteiligten Schauspielern und dem Rest des Regieteams weiter fortklingen. Wenn die eigene Idee nichts in den Anderen auslöst, wird sie als Totgeburt in der Bühnenecke verwesen.
Wichtigste Triebfeder sollte also die Neugier sein: zunächst die Neugier darauf, was der Text in mir und den Anderen auslöst und welche Energien in den Proben entstehen. Am Ende die Neugier darauf, was sich in mir selber formt, welche Klänge ich höre. Der große Theaterkomponist Laurent Simonetti sagte mir einmal, dass er keine Musik herstellen würde, bevor er sie nicht innerlich hören würde. Das fand ich unmittelbar einleuchtend und habe ich mir zu Herzen genommen. Und so kann es vorkommen, dass ich wochenlang anderen Menschen (den Schauspielern, dem Regisseur, den Ausstattern) beim Arbeiten zuschaue, bevor ich selbst weiß, was ich dazu beitragen kann. Dieses Wissen ergibt sich aus dem Zuhören, nicht nur der Anderen, sondern mir selber. Inzwischen kann ich zuverlässig beurteilen, ob eine Idee für das Stück stimmt oder nicht: nämlich daran, wie konkret sich der Klang oder die Musik in mir formuliert.
Es geht hier viel auch um Geduld. Dass man mitunter wochenlang vermeintlich passiv daneben sitzt, geht ans Selbstbewusstsein, da bin ich auch heute noch anfällig. Manchmal entsteht der innere Klang auch erst wenige Tage vor der Premiere. Dann muss (und kann eben auch) alles innerhalb weniger Tage produziert werden.
In den Endproben passiert dann auch der Prozess der Übergabe an die Tonabteilung, die das Stück nach der Premiere ohne mich im Repertoirebetrieb fährt und betreut. Die Reibungsverluste, die da entstehen können, sind ein echtes Thema. Da probt man wochenlang und die eigenen Finger am Regler machen intuitiv genau das, was sie machen sollen und dann muss man das alles mühsam ausformulieren und in viele kleine und genaue Verabredungen verpacken. Im Prinzip ist das wie beim Komponieren, wenn man für Musiker eine Partitur herstellt. Wie formuliert man seine Vorstellungen, seinen inneren Klang, so, dass der Andere ihn versteht, aber nicht nur sklavisch eins zu eins ihn reproduzieren muss, sondern sich selbst, seinen eigenen inneren Klang darin wiederfinden kann? Ich denke, man sollte versuchen, den Anderen mitzunehmen auf seine eigene Reise, ihn daran beteiligen. Das geht, wenn man sich für ihn interessiert und auf seinen Beitrag neugierig ist.
(Dass ich durchgehend in männlicher Form von den Kollegen spreche, ist der sprachlichen Einfachheit oder auch Faulheit geschuldet. Tatsächlich scheint mir die Frauenquote bei den Theatertonmeistern erfreulich hoch.)