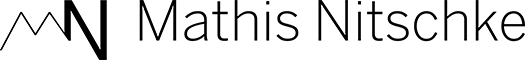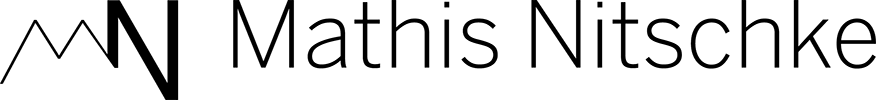Mein Beitrag zur Ringvorlesung des Forschungsinstituts für Musiktheater (fimt) der Universität Bayreuth: „Oper und Co. für die Zukunft?“ – Musiktheater zwischen Institution, Digitalität und künstlerischer Forschung
Online, 28.11.2023
Verstärkter Gesang
„Was ist eigentlich Oper?“ Diese Frage war die meiste Zeit meines Lebens nicht relevant. Als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener fand ich klassischen Gesang bestenfalls skurril. Die wenigen Opern, die ich gesehen habe, hielt ich für altbacken und fad. Ich liebte aber immer das Theater und fand Aufregendes in Produktionen freier Gruppen, bei denen ich leidenschaftlich mitmachte. Je mehr Musik darin vorkam desto besser. Schauspiel wurde mir schnell zu viel Gequatsche. Ich fand die Idee des Musicals eigentlich immer überzeugend, wurde aber meist vom Kitsch enttäuscht.
Als ich in Den Haag Komposition studierte, lernte ich die flämisch-holländische Musiktheaterszene kennen. Einer ihrer wichtigsten Protagonisten, Paul Koek, erklärte den Begriff „Musiktheater“ als kämpferischen Gegenbegriff zu „Oper“, die er sowohl von den Stücken als auch von den Institutionen her als unterkomplex, diskriminierend und rückständig abwertete. Wer eine Oper komponierte, wurde dort belächelt statt bewundert.
Musiktheater folgt der Logik der Musik statt der Worte, nutzt heutiges Instrumentarium, es kann dabei, muss aber nicht gesungen werden, ist eher aus technologischer Spiellust entwickelt, denn aus inhaltlichem Sendungsbewusstsein, vermeidet Hierarchien und sucht gerne auch mal die Konfrontation. Genau mein Fall. Ich kreierte also aus voller Überzeugung und mit herzlicher Opernabneigung experimentelles Musiktheater.
Und dann passierte es: 2010 wurde mir von der Nationaloper Montpellier ein Kompositionsauftrag für eine „Große“ Oper angeboten, mit all dem klassischen Besteck: Orchester, Chor, Solisten. Dabei schien mir doch die Idee einer Oper bisher grotesk und abwegig.
Zu der Zeit war mir Heiner Goebbels ein wichtiger Mentor. „Die klassischen Bühnenkünste beruhen immer auf Hierarchisierung,“ schrieb er 1997 in Gegen das Gesamtkunstwerk: Zur Differenzierung der Künste. „Diejenige [Kunst], die im Zentrum steht, macht sich breit und zwingt die anderen zur Unterordnung, funktionalisiert sie zu ihrer Unterstützung, um selbst stark zu sein, um all ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, alle ihre Kräfte zu entwickeln, um ihr Terrain zu verteidigen und zu glänzen.“ Damit meint er vor allem das Schauspiel, in dem seiner Erfahrung nach Bühnenbild, Kostüm, Musik, Licht etc. lediglich den Text illustrieren statt eigenständige, vom Text losgelöste Bedeutungsebenen zu entfalten.
Er schlägt das Gegenteil des Wagnerschen Begriffs von Gesamtkunstwerk vor: „nicht die Vernichtung der Einzelkünste zu höheren Zwecken, sondern die Chance ihrer Behauptung in der wechselseitig sich ablösenden, in einem kontinuierlichen Schwebezustand gehaltenen Präsenz.“ Das bedeutet konkret, „dass das Licht in einer Inszenierung auch einmal wichtiger sein kann als das gesprochene Wort, dass die Bewegung des Akteurs ein vom Text getrenntes Eigenleben hat, dass das Geräusch das Bild ersetzt oder die Musik die Szene weitererzählt.“
Diese voneinander unabhängige, aber wechselseitige Co-Existenz der Künste ist seiner Einschätzung nach nur von einem Team im Prozess entwickelbar, „einer allein kann das alles gar nicht mehr erfinden.“ Und nun sollte ich also für die absolut hierarchische Struktur der tradierten Opernmaschine alleine eine Partitur schreiben, die top-down jegliche Prozesshaftigkeit während der Proben unmöglich macht? Und nicht zu vergessen, fand ich klassischen Gesang ja immer noch bestenfalls skurril und das Opernpublikum sowieso viel zu alt.
Trotzdem sagte ich zu. Zu verlockend war die Aussicht auf die große Bühne. Um aber überhaupt ins Schreiben zu kommen, musste dringend die Frage geklärt werden: „Was ist eigentlich Oper?“ Zu eindeutig hatte ich bisher diese Frage mit Vorurteilen beantwortet. Ich aber wollte den Auftrag ernst nehmen. Ich wollte keine Anti-Oper komponieren, so wie es viele Kollegen tun. Ich wollte der Form gerecht werden, es wirklich und ernsthaft versuchen.
Ich identifizierte bald den Gesang als definierendes Element der Oper, so banal das vielleicht klingen mag. Musiktheater versucht meist, zumindest den klassischen Gesang zu vermeiden. Wenn überhaupt gesungen wird, dann mit Pop- oder Jazzstimme oder mit ethnischen Stimmen. Andersherum musste also der klassische Gesang das sein, was die Oper zur Oper macht. Diese, wie gesagt, möglicherweise banale aber in ihrer Klarheit hilfreiche Einsicht kombinierte ich mit Peter Brooks berühmten Sätzen: „Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mensch geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“
Meine Arbeitshypothese lautete also: Oper ist Gesang auf der Theaterbühne. Die Differenzierung klassischer Gesang habe ich wieder weggelassen. Damit nehme ich in Kauf, dass Musical zur Gattung der Oper gehört, warum auch nicht, vor allem aber bin ich überzeugt, dass auch große inszenierte Pop-Acts wie Rammstein eigentlich Oper sind. Was ist denn sonst Oper, wenn nicht das? Die Fülle, die Strategien der musikalischen wie visuellen Überwältigung, das Zusammenbringen aller möglichen, vor allem auch der technologisch modernsten Künste, auch der kommerzielle Gedanke, der gezielte Tabubruch, das gehört doch alles zu Oper, wenn man sie sich historisch anschaut und nicht in ihrem heutigen Museumszustand.
Der Kern aber bleibt: Oper ist Gesang auf der Theaterbühne. Nachdem ich in Montpellier klassische Sänger*innen hatte, galt meine Hauptbeschäftigung anfangs also dem klassischen Gesang als „Problem“. Denn weder wusste ich viel darüber, noch interessierte er mich bisher. Ich suchte Gespräche. Für die Opernliebhaber ist er der Himmel auf Erden. Und wenn man sich mit Nicht-Opernliebhabern unterhält, dann lieben die meist deswegen die Oper nicht, weil sie den klassischen Gesang nicht lieben. Er erscheint ihnen artifiziell, gekünstelt, „als ob den Sängern jemand die Eier abgeschnitten hat“ (Zitat). Ich gehörte dummerweise eher zum zweiten Lager, doch irgendwann öffnete sich mir aus eher unvorhergesehener Richtung eine Tür.
Denn ich stellte fest: In einer Welt, die bestimmt ist von psychologisch möglichst glaubhafter (also normativer), naturalistischer Spielweise in Film und Fernsehen spielt das Artifizielle, das Künstliche kaum noch eine Rolle. Das empfinde ich als Verlust. Musiktheater sperrt sich gegen die Naturalismusfalle durch gezielte Abstraktion. Oper treibt das aber noch weiter: Es gibt doch kaum etwas Artifizielleres in unserem Leben als singende Menschen auf der Bühne! Welch grandiose Kulturleistung!
Das Amalgam der Musik und des Singens kann sich fremde Elemente co-existieren lassen, verbindet Dinge, die wir sonst nicht zusammenbringen und hebt das Gesamtgeschehen auf eine sinnliche Metaebene. Aus dieser Perspektive erschien mir das Singen nun nicht mehr als die höchste aller Künste, der sich alles andere unterzuordnen hat, sondern als Nährboden, aus dem etwas entstehen kann.
Ich liebe Heiner Müllers Definition des Gesangs als ‚Vorsprache‘. Für ihn ist Gesang nicht das, was kommt, wenn die Worte ausgehen, sondern das, bevor die Worte entstehen. Irgendwann lernte ich: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen klassischer Gesangstechnik und dem Schreien von Babys. Das fand ich sehr interessant. So lernte ich den klassischen Gesang lieben.
Der klassische Operngesang stammt aus einer Zeit, in der große Distanzen (z.B. zwischen Bühne und zweitem Balkon) akustisch gar nicht anders zu überbrücken waren. Wir sind aber heute umgeben vom Klang nahmikrofonierter Stimmen. Im Pop wird leise und intim gesungen, das Mikrofon fischt jedes kleinste Detail. Das ist ein bisschen so, wie man als Kind von den Eltern sein Gute-Nacht-Lied gehört hat. Da ist auch eine erotische Nähe zur Stimme. Ich glaube, aus dieser Prägung heraus existiert so viel Ablehnung gegenüber dem klassischen Gesang. Wenn man heute eine Oper komponiert und den Anspruch hat, auch mit Nicht-Opernliebhabern in Kommunikation zu treten, muss man dazu eine Haltung und einen Umgang finden, denn aus der nahmikrofonierten Perspektive wirkt der Operngesang in der Tat befremdlich und museal.
Deswegen war es von Anfang an für mich klar, dass ich mit elektroakustischer Verstärkung und Live-Elektronik arbeiten werde, um den klassischen Gesang zu rahmen und zu kontextualisieren. Für mich war es sehr interessant, mit wechselnden akustischen Perspektiven zu arbeiten. Szenen, in denen ich die Stimme verstärkte und auch mit Effekten behandelt habe, erlauben Brecht’sche Verfremdungen und Unschärfen, die in nachfolgenden rein akustischen Szenen die Sensation des unverstärkten klassischen Gesangs umso klarer und pointierter hervortreten lassen.
Für die Oper installierte ich eigens ein aufwendiges Surround-System in 3 Dimensionen (links/rechts, vorne/hinten, oben/unten), das erlaubte mir eine besonders immersive Klangarbeit. Ein paar konkrete Beispiele:
Die Oper JETZT fing mit purer a-capella Alt Stimme an, als ein deutliches Statement für den Gesang, allerdings verstärkt und mit Effekten ergänzt. Der Klang wurde von Lautsprechern im Auditorium wiedergegeben, so dass das Publikum in die Stimme eingetaucht wurde, statt von einer Person auf der Bühne angesungen zu werden. Den Gesang habe ich mit verschiedenen Live-Effekten immer weiter angereichert. Am Ende des Prologs saß das Publikum in einer „Kathedrale aus Klang“, nur aus der Altstimme fabriziert. Das Überwältigende, dass ich mir von Oper erwartete, erreichte ich gleich zu Anfang mit nur einer Stimme.
In einer weiteren Szene nahmen alle 5 Solisten ein Megaphon in die Hand und schalteten es, nach Partitur, nur für winzige Zeiträume ein, während sie sehr lange Noten singen. Diese Impulse führen zu einer neuen Melodie, die aus den 5 Liegetönen erwächst.
Und warum sollte man den fliegenden Astronauten, der ins All schwebt, nicht über ein Funkgerät hören? Es ist mir unverständlich, warum in der klassischen Oper solche Szenen so gut wie nie mit Filtern wie im Film behandelt werden.
Sampling
Im Gespräch mit Komponisten, die wie ich ebenfalls die Erfahrung einer geglückten eigenen Oper gemacht haben, stelle ich immer wieder fest: es ist ein geiles Erlebnis.
Fast immer jammern die Kollegen zwar über den unglaublichen Berg an Arbeit, der zu erledigen ist und die mickrigen Gelder, die dem dagegenstehen, fast immer werden aber auch die Augen feucht, wenn von der resultierenden Aufführung berichtet wird. Dadurch, dass es im heutigen Opernbetrieb selten Wiederaufführungen gibt, sind neue Opern nach wenigen Vorstellungen meist wieder gestorben. Und trotzdem kenne ich kaum einen Komponisten, der den Aufwand nicht nochmal machen würde.
Ich bekam die Gelegenheit zu einer neuen Oper bereits ein Jahr später, ebenfalls an der Nationaloper Montpellier. Wieder fragte ich mich: was ist eigentlich Oper? Kann sie nicht auch etwas Schnelllebiges und wirklich Aktuelles sein, statt dem Eindruck nachzueifern, dass hier Werke für die Unendlichkeit geschaffen werden müssen? Im vollen Wissen, dass die neue Oper sowieso nicht lange existieren wird, versuchte ich also, so, wie ich es aus dem Schauspiel kenne, aktuelle Gegenwart zu verhandeln, das Risiko in Kauf nehmend, dass die Oper schnell veraltet sein wird.
Sampling sowohl auf Text- wie auch auf Musikebene wurde hier meine maßgebliche Kompositionstechnik. Und als elektro-akustischer Hybrid konzipiert, spielte die Verstärkung in HAPPY HAPPY eine strukturell noch tiefergehende Rolle: die Instrumentierung setzte ich bewusst ins Ungleichgewicht. Acht Solo-Streicher mussten sich gegen sieben Blechbläser, einfaches Holz, 3 Schlagwerker sowie Sampler und Synthesizer behaupten. Um das Ungleichgewicht wieder auszugleichen habe ich die Solo-Streicher verstärkt, was einen eigenen Sound produzierte.
Die Sängerin trug ein Kopfbügelmikrofon, sang aber Szenen mit Verstärkung und Szenen ohne Verstärkung, je nachdem, welchen Klang die Szene verlangte. Manche waren jazzig angelegt oder imitierten Pop, dort wurde verstärkt. Dann wieder gab es Szenen, die eher als Lied oder Opernarie angelegt waren und die pure akustische Stimme in den Fokus stellten. Für extreme Effekte und noch direkteren Klang nutzten wir eine Handmikro. Ich begriff das Mikrofon als einen meiner Parameter, mit dem ich komponieren kann.
Der Epilog knüpfte an den Prolog aus JETZT an: Die Sängerin sang a-capella in einen Looper und baute damit einen harmonischen Akkord aus ihrer eigenen Stimme auf. Dieses geloopte Echo hörte man aus der Kuppel und so saß man wieder in der Stimme drin.
Die Protagonistin in Happy Happy ist – verkürzt zusammengefasst – eine Frau, die eigentlich immer nur singen will, in diesem Bedürfnis aber existentiell in Frage gestellt wird. In unserer effizienzorientierten Gesellschaft haben künstlerische Tätigkeiten wie das Singen kaum einen Wert. Singen ist kein wirtschaftlich relevantes Produkt. Viele Kulturmanager versuchen aus Legitimationsdruck heraus die Kosten für Musik und Gesang als auch wirtschaftlich sinnvoll zu rechtfertigen. Das finde ich eine völlig falsche Diskussion. Singen ist kein Produkt. Singen ist eine Tätigkeit, eine Fähigkeit, die uns zu Menschen macht. Von der Stimme einer Sängerin oder eines Sängers berührt zu werden, macht uns menschlich. Als humanistische Gesellschaft sollten wir die Kosten für Musik und Gesang als Mittel begrüßen, um uns als Menschen definieren zu können.
Ich habe es als Notwendigkeit, geradezu als Pflicht angesehen, dies zu meinem Thema zu machen, und natürlich habe ich gehofft, dass das Opernhaus meine politische Botschaft aufgreift, um zu informieren, zu diskutieren und seine Positionen und Interessen zu verteidigen. Ich arbeite viel im deutschsprachigen Theater, und dort ist es seit langem üblich, politisch zu sein und handeln. Es gibt öffentliche Diskussionen und Symposien, neben der eigentlichen künstlerischen Arbeit, um das Theater als Ort der Gesellschaft zu begründen, an dem man ästhetisch in Gesellschaft über Gesellschaft reflektieren kann (Dirk Baecker/Ulf Schmidt[1]). Ich habe mich zur Verfügung gestellt, an Diskussionen teilzunehmen und Vorträge zu halten. Leider hatte das Haus kein Interesse daran.
Ich hoffte vor allem, dass diese Veranstaltungen an Orten stattfinden würden, wo die so genannte Nicht-Öffentlichkeit hingehen würde. Die Erfahrung von JETZT zeigte, dass meine Arbeit auch Menschen anspricht, die nie in die Oper gegangen sind oder wenn, davon befremdet oder, schlimmer noch, gelangweilt waren. Nicht-Opernliebhaber davon zu überzeugen, dass Gesang für unsere Gesellschaft lebenswichtig ist, ist seitdem meine Mission.
Die Oper als Institution ist nicht Teil des politischen Diskurses. Oper ist nicht wichtig als Teil eines gesellschaftspolitischen Engagements. Das war vielleicht nie anders und wird sich wohl auch nie grundlegend ändern. Aber sollten wir nicht wenigstens versuchen, das zu ändern?
Ja, zeitgenössische Produktionen werden gelegentlich in Auftrag gegeben. Aber nicht, weil man glaubt, dass wir wirklich zeitgenössische Opern brauchen, um unsere aktuelle Zeit musikalisch auszudrücken. Vielmehr wird das wohl eher gemacht, um die Gelder zu rechtfertigen. Und es ist irgendwie schick und exotisch. Aber es kommt weder aus einem inneren Drang noch ist ein echtes Bedürfnis dahinter. Man tut es, weil es stilvoll scheint. Ich glaube nicht, dass ich Unrecht habe, wenn ich denke, dass die meisten Leute in der Opernwelt gut ohne uns Komponisten leben könnten und sich am liebsten an ihre alten „Hits“ hielten. Die Verwaltung dieser Stücke ist einfach und völlig vorhersehbar.
Was für eine Chance wird hier vertan! Wir leben in einer Situation, in der Popmusik und Film doch ihr Identifikationspotenzial weitgehend verloren haben. Der Ökonomisierungsprozess hat seit über 20 Jahren diese Branchen übernommen und erzeugt Produkte für Zielgruppen. Niemand will doch ernsthaft eine Zielgruppe sein. Das Publikum konsumiert diese Produkte, ja, es gibt ja kaum anderes, aber es identifiziert sich nicht mit ihnen. Wenn wir ihnen Alternativen aufzeigen würden – und moderne Oper kann eine wirklich starke Alternative sein -, würden sie es zu schätzen wissen, davon bin ich überzeugt.
Ich glaube tatsächlich, dass Oper eigentlich die aktuellste und zeitgenössischste Kunstform sein könnte, wenn man sie entsprechend behandeln würde. Eine Begegnung von Mensch zu Mensch zum Austausch von Erfahrungen emotionaler und spiritueller Natur: das ist, was ein Opernabend aus meiner Sicht besser kann als alle sprachbasierten Künste.
Eine klingende Membran zwischen Innen und Außen
Ja, Sie merken es schon: ich war und bin enttäuscht von der Institution Oper. Ich erinnerte mich an meine Vergangenheit in freien Theatergruppen und entschied mich, die Frage: „Was ist eigentlich Oper?“ ohne Opernhaus weiter zu explorieren. Dabei interessierten mich – als Gegenpole – der öffentliche Raum und der digitale Raum. Ich hatte Lust, das im besten Sinne Artifizielle des Operngesangs mit der Profanität des Alltags zu konfrontieren.
Oper ist meiner Definition nach Gesang auf der Theaterbühne. Was kann denn noch eine Theaterbühne sein, außer der Bühne im Opernhaus?
Bei einer Begehung des Zentrums von Pasing, ein Stadtteil Münchens, entdeckte ich 2015 das Schaufenster einer Apotheke, das den Blick aus der Apotheke hinaus auf das öffentliche Treiben des Bahnhofplatzes rahmte. Da hatte ich also meine Bühne. Allein schon durch die Lenkung des Blicks durch die Bestuhlung in der Apotheke verwandelte sich der Bahnhofplatz draußen in ein Bühnenbild und das Zufällige der Passanten in eine Inszenierung.
In diesem Bühnenbild tauchte dann Viola auf, eine offenbar traurige und desorientierte Frau. Sie schien unter Schock zu stehen, den Bezug zu Zeit und Raum verloren zu haben: „Ist das jetzt Innen oder Außen? Ist heute noch gestern?“
Die Zuschauer*innen konnten Viola hören, denn Körperschallwandler (sog. Transducer) übertrugen Violas Stimme auf die Glasscheiben der Schaufenster. Die verwandelten sich so zu einer klingenden und vibrierenden Membran zwischen dem Innen und Außen. Um Viola aber sehen und erkennen zu können, musste das Publikum seinen Blick scharfstellen auf diesen einsamen und befremdlichen Menschen inmitten des geschäftigen Treibens auf dem Platz.
Die Stimme wird in dieser Installation konkret und physisch zum verbindenden Element zwischen Innen und Außen, zwischen Publikum und Akteuren gemacht. Irgendwann verwischen sich diese Zuordnungen und Rollen, denn die Passanten draußen erspähen die sie anblickenden Menschen drinnen, im vermeintlich geschützten Refugium der Apotheke. Erkannt und entlarvt wird hier der Betrachter der Szenerie nun selbst zum Darsteller. Angestarrt durch die Schaufensterscheibe dient er plötzlich der Unterhaltung der draußen stehenden Personen – ein Exponat im Glaskasten. Die Scheibe, die Stimme, fungiert als durchlässige Membran, die das Wechselspiel zwischen innen und außen unaufhaltsam vorantreibt.
Oper als In-der-Welt-Erlebnis
Nun war ich also aus dem Opernhaus draußen, hab meine Bühne im öffentlichen Raum gefunden. Eine Frage beschäftigte mich allerdings weiterhin, aus dem Frust der wenigen Vorstellungen in Montpellier geboren: Gibt es Oper auch unabhängig vom Spielplan?
Man könnte sich vorstellen, auf dem Pasinger Bahnhofplatz einen Lautsprecher aufzubauen, der immer verfügbar eine singende Stimme wiedergibt. Wäre das dann immer noch „Gesang auf der Theaterbühne“? Nein, das empfände ich nicht so. Die Erklärung findet man bei Peter Brook: diese Situation wäre keine Theaterbühne mehr, denn die braucht die leibhaftige Ko-Präsenz von agierender und zuschauender Person im Raum. Meine Definition bleibt also durch diese Falsifikation intakt.
Wenn ich jetzt aber bei VIOLA die Zuschreibungen, wer agiert und wer zuschaut, schon so erfolgreich auflösen konnte, wäre es dann nicht vielleicht auch möglich, ein und dieselbe Person zu Akteur und Zuschauer gleichzeitig zu machen? Ist das nicht genau das, was Computerspiele machen?
Einer weiteren Spur folgte ich parallel: dem Ritual. Bei der Frage nach dem Besonderen eines Opernbesuchs kommt man recht schnell auf die nur vermeintlich naheliegende Feststellung der Weltflucht in die anti-alltägliche Gegenwelt des Gesangs. Singende Menschen auf der Bühne sind nichts, womit wir im alltäglichen Leben konfrontiert und umgeben sind. Diese im besten Sinne artifizielle Welt des Gesangs in Gemeinschaft zu erleben ist meiner Einschätzung nach einer der Hauptgründe für das starke Empfinden in der Oper.
Um sich in diese Gemeinschaft zu begeben, muss man sich als Zuschauer erst mal aufmachen. Man muss aufbrechen und sich zum Opernhaus hinbewegen. Dieser Aufbruch, diese Entscheidung zum Aufbruch öffnet einen: man bricht sich auf und macht sich für die Musik empfänglich. Man muss sich also erst mal selbst bewegen, bevor man von der Musik bewegt werden kann.
In unserer medialen Welt ist der Aufbruch zu etwas Freiwilligem geworden, in der prä-medialen Welt war man zum Aufbruch gezwungen (selbst auf dem Sofa zum Plattenspieler hin). Heute kommt die Musik zu uns, per Internet. Ganze Operninszenierungen kommen heute zu uns nach Hause, als Livestream. Die Musik bewegt sich selbst, sie bricht zu uns auf, in der Hoffnung, uns berühren zu können. Müssen wir uns also vielleicht neue Rituale erfinden, um die Musik willkommen zu heißen?
Bei der Schallplatte war es vielleicht das Aufsetzen der Nadel und das darauffolgende Knistern, das den Vorhang öffnete. Könnte das ein Grund für die wiedererwachte Liebe zur Schallplatte sein?
Was wäre, wenn es doch um den körperlichen Aufbruch geht? Wenn die Bewegung in die Welt die Bewegung aus der Welt erst möglich macht?
Diese Überlegungen begegneten sich mit der Erinnerung an den persönlichen musikalischen Begleiter in meiner Jugend: der Walkman, der mir den Soundtrack zur eigenen Bewegung als private Erfahrung lieferte. Der Kopfhörer reduziert nicht den Hörsinn, sondern die Musik transformiert die visuelle Erfahrung der umgebenden wirklichen Welt und reichert sie an; sie macht sie komplexer. Es findet eine audio-visuelle Verknüpfung statt, die im besten Fall die Realität in eine künstlerische Erfahrung transformiert.
Die heutigen Walkmen, die Smartphones, sind mit GPS-Sensoren ausgestattet. Sie wissen, wo in der Welt sich ihre Nutzer*innen befinden. Eine App kann dann diese Information nutzen, um ortsspezifische Musik abzuspielen. Musik, die nur dann erklingt, wenn der Hörer sich an diesen besonderen Ort begeben hat.
Wenn man als Komponist eine Musik für diesen jeweiligen Ort komponierte, die in der Lage wäre, eine Transformation der visuell wahrgenommenen realen Welt in ein opernhaftes Bühnenbild herbeizuführen, dann könnte die Bewegung selbst, z.B. ein Spaziergang, zur Oper werden.
Zurück zur Stimme, die nun also medial vermittelt aus dem Smartphone abgespielt wird und im Kopfhörer zu hören ist. Wäre es in Zeiten der Humanoide nicht sinnfällig, das Smartphone selbst als Akteur zu begreifen und ihm eine Stimme zu geben? Was wäre, dachte ich, wenn man einen Spaziergang mit seinem Smartphone macht und das Phone mit seiner Nutzerin oder seinem Nutzer spricht bzw. singt?
Die Du-Ansprache in der Oper ‚Vergehen‘ macht das Smartphone zum Gegenüber. Dadurch, dass im Text auf spezifische Orte und Situationen eingegangen wird, entsteht Liveness. Der Text, aufgeteilt auf drei Stimmen, alle das Phone bzw. die damit verbundene digitale Welt repräsentierend, beschäftigt sich mit der Ambivalenz, mit der wir der digitalen Welt begegnen. Zum einen lieben wir den Komfort der vernetzten Mobilität, zum anderen fürchten wir die gläserne Transparenz, der wir uns aussetzen.
Die komplexe Interaktivität der eigens programmierten App trägt ebenfalls zum Eindruck eines Gegenübers bei. 3D-Audio Technik sorgt dafür, dass man sich wie auch schon bei den Opern teilweise in der Stimme bzw. die Stimme im Kopf befindet, oder sie wird durch sog. binaurale Externalisation von außen gehört. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zum Eindruck eines Gegenübers.
Ein fruchtbarer Nährboden
Die hier beschriebenen prägenden Fragestellungen in den Jahre 2010 bis 2016 waren für mich aufrüttelnd und streckenweise geradezu existentiell (viel der Energie in Happy Happy, z.B., stammt aus meinem zermürbenden Frust, als Künstlerfamilie in München eine Wohnung zu finden). Die Antworten, die ich für mich aus dieser Zeit der künstlerischen Forschung gewann, erweisen sich seither als äußerst fruchtbare Grundlage für:
- MAYA, die erste Mixed-Reality-Oper weltweit (2017), die zentrale Fragen der Posthumanität diskutierte. In den Ruinen des ehemaligen Heizkraftwerks Aubing bei München kreierten wir auf der Basis von Klang, Musik, Augmented-Reality-Technologie und digitaler Kunst einen virtuellen Kosmos parallel zur realen Welt. Auch hier stand das Smartphone im Zentrum der konzeptionellen und dramaturgischen Überlegungen.
- Den Ausbau von VIOLA zur Trilogie VIOLA/KATHARINA/ISOLDE (2014/16/19), an weiteren öffentlichen Orten in München.
- Die interaktiven 3D-Audio Hörspaziergänge ‚Frühling‘ (2019) und ‚Die Planeten‘ (2022), die in Zusammenarbeit mit den Münchner Philharmonikern entstanden sind.
- ‚Lure‘ (2020), ein Projekt an der Schnittstelle von Musik, Theater und Künstlicher Intelligenz, das Covid-bedingt zu einem Prototyp für eine theatrale Inszenierung im digitalen Raum eines Zoom Meetings wurde.
Ich nahm die Einladung als Referent für den Auftakt des Themenfelds Technisierung und Digitalität der online Ringvorlesung am Forschungsinstitut für Musiktheater der Uni Bayreuth gerne an und als Gelegenheit wahr, mir nochmal darüber bewusst zu werden, welche Schritte mich zu den Arbeiten führten, die ich heute mache. Denn in den letzten Jahren beklagen mich Zweifel, ob ich mich nicht wiederhole, dieses aufregende Gefühl grundlegender Entdeckungen geht mir ab. Aber ich kann nun erkennen, dass ich mir eine Grundlage, einen Nährboden geschaffen habe, aus dem heraus ich verschiedenste Pflanzen ziehen kann. Das war sehr aufschlussreich und hilfreich für mich und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
Gleichzeitig hoffe ich, dass es mir gelungen ist, Ihnen zu vermitteln, dass es existentielle künstlerische Fragen und Zweifel waren, die im Besonderen mich, aber viele Kollegen auch zur Arbeit mit neuen und neuesten Technologien bringen. Es ist eben nicht so, wie allzu häufig kolportiert, dass die Techniken nur aus modischem Appeasement heraus genutzt werden, sondern sie werden, wie von Peter Brook gefordert, genutzt, um totes Theater zu vermeiden und lebendiges Theater hervorzubringen.